Wahlpflichtunterricht Informatik
in den Klassen 9 und 10.
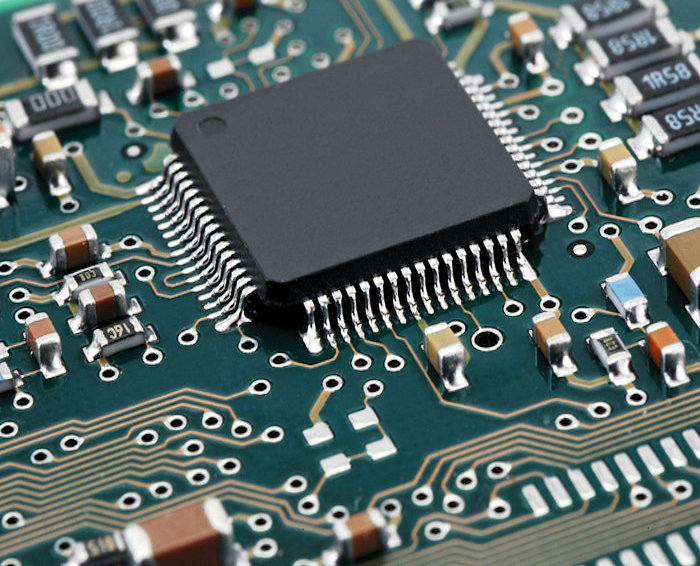
Der Wahlpflichtunterricht bereitet den Informatikunterricht in der Oberstufe vor. Möchte eine Schülerin oder ein Schüler das Abitur in Informatik ablegen, so muss er den Wahlpflichtunterricht besucht haben. Eine mindestens dreijährige Teilnahme am Informatikunterricht ist für das Abitur Voraussetzung.
Der Beginn des WPU in Klasse 9 mit der funktionalen Sprache Haskell garantiert allen Schülern einen nahezu gleichen Start. So werden Schüler mit weniger Erfahrung nicht von vorherein entmutigt, weil die „Cracks“ schon alles wissen.
Als zweite Unterrichtssprache wird Python verwendet.
Wichtig ist neben soliden Kenntnissen in der Softwareentwicklung einen Überblick über die Teilgebiete der Informatik zu bekommen. So sind viele Schüler erstaunt, wenn sie lernen, dass Informatik sich doch an vielen Stellen vom Medienunterricht der Klassen 5 und 6 unterscheidet.
Algorithmen und Datenstrukturen I
Datenmodellierung: Variablen, Konstanten, Standard-Datentypen, Reihungen, Listen, Dictionaries
algorithmische Steuerstrukturen: Anweisungen, Operatoren, Kontrollstrukturen (Sequenz, Auswahl, Schleifen, Rekursion)·
formale Darstellung der algorithmischen Grundbausteine als Struktogramme, Pseudocode
Prozeduren/ Methoden (wertliefernde und nicht-wertliefernde), Parameter, Klassenbenutzung, Methodenaufruf, Dateizugriff, Hinweis auf Software-Bibliotheken
Modellbildung und Systeme: Analyse und umgangssprachliche Notierung, Zuordnen von Daten und Zugriffen, Software-Lebenszyklus
Algorithmusbegriff (naiv)
„Programmieren im Kleinen“: Lösen vielfältiger Aufgabenstellungen mit Hilfe des Computers
Spezifikation von algorithmischen Lösungen im Sinne einer Schnittstellenbeschreibung (verbal: Angabe von Voraussetzung und Effekt beziehungsweise Ergebnis)
- Objektorientierung (Objekt, Klasse, Benutzung von Instanz- und Klassenattributen bzw. Methoden)
Testverfahren: Fehlerbeseitigung (Debugging), Zuverlässigkeit von Systemen
Dokumentation: umgangssprachliche und grafische Darstellungen von Algorithmen und Datenstrukturen, Effektbeschreibungen, Testläufe, Arbeitsgruppenergebnisse, Handbücher, Nutzung von fertigen Dokumentationsformaten und ‑vorlagen, Nutzen von Fremddokumentation
Historisches
Anfänge der Computerentwicklung bei Militär, Forschung und Großindustrie, Großrechner, Mikrocomputer, Ursprünge der PC-Betriebssysteme, Miniaturisierung und Preisentwicklung
Geschichte des Internets
Rechnereinsatzes in der Gesellschaft: Computer als „Universalmaschinen“, Veränderung von Lebens- und Arbeitsbedingungen, Verantwortung für den Einsatz von Informatiksystemen, Verschwinden von Berufen, Aufkommen neuer Berufe, Abhängigkeit, militärische und zivile Nutzung, Softwareindustrie und Open Source, Lizenzmodelle
Netzwerktechniken
Protokolle als Vereinbarungen zwischen Kommunikationspartnern, Protokolle in Schichten,
Zwei-Schichten-Modell: Diensteschicht (OSI 1–4) zum Transport von Bitströmen und Anwendungsschicht für Anwendungen, Adressierungen in Netzen, kabelgebundene und Funknetze, Mobiltelefonnetze, Knoten- beziehungsweise Zellenstruktur und Paketdienst, Telephonie als Netzwerkanwendung, beispielhaft ein Internet-Dienst (zum Beispiel E‑Mail, Chat, Foren)
Relationale Datenbanken I
Tabelle, Merkmal, Schlüssel
Komponenten eines relationalen Datenbankmanagementsystems (DBMS)
ER-Modell: Assoziationstypen als N:M‑Notation (synonym: Kardinalitäten, Funktionalitäten)
Relationales Datenbankschema
Regeln zur Herstellung einer minimale Tabellensammlung
einfache Abfragen in SQL (Selektion, Projektion, Equipment-Join)
Datenschutz: Recht auf informationelle Selbstbestimmung, Datenschutzgesetze, Rechte als Betroffener, Datenschutzbeauftragter, Datenspuren und Data-Mining, Verbraucherschutz, aktuelle Probleme des Datenschutzes (Internet, social media)
Technische Informatik
Darstellung von Informationen: Stellenwertsysteme, Umwandlungsverfahren
Rechnen in IB
Boolesche Funktionen (mathematische und technische Darstellung durch Gatter)
Aufbau und Funktionsweise von Rechneranlagen, von Neumann-Modell
Schaltnetz: Analyse und Synthese (Halb- und Volladdierer, Komparationen, Anwendungsschaltungen)
Minimierung von Schaltnetzen (Verfahren von Karnaugh und Veitch)
Simulation und Testen von Schaltnetzen
Unterrichtsmaterialien
Klasse 9
Klasse 10
- boolesche Regeln (Kreißigsche Übersicht)
